Albert SCHWEITZER
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Albert SCHWEITZER |
|
||
| occupation | Arzt, evangelischer Theologe, Organist, Philosoph und Pazifist. |
[1]
|
||
| title | Dr., Friedensnobelpreisträger |
[2]
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | 4. September 1965 | Lambaréné, Moyen-Ogooue, Gabon
Find persons in this place |
[2]
|
| burial | Lambaréné, Moyen-Ogooue, Gabon
Find persons in this place |
[2]
|
|
| birth | 14. January 1875 | Kaysersberg, Haut-Rhin, Alsace, France
Find persons in this place |
|
| marriage | 15. June 1912 | Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Find persons in this place |
[3]
|
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
15. June 1912
Strasbourg, Bas-Rhin, Alsace, France |
Helene BRESSLAU |
|
Notes for this person
Schweitzer gründete ein Krankenhaus in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun. Er veröffentlichte theologische und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, insbesondere zu Johann Sebastian Bach, sowie autobiographische Schriften in zahlreichen und vielbeachteten Werken. 1953 wurde ihm der Friedensnobelpreis für das Jahr 1952 zuerkannt, den er 1954 entgegennahm. Frühe Jahre und Ausbildung Schweitzer stammte aus einer alemannisch-elsässischen Familie. Geboren wurde er als Sohn des Pfarrverwesers Ludwig (Louis) Schweitzer, der eine kleine evangelische Gemeinde betreute, und dessen Frau Adele, geb. Schillinger, der Tochter eines Mühlbacher Pfarrers im Reichsland Elsass-Lothringen. Noch im Jahr seiner Geburt zog die Familie von Kaysersberg nach Günsbach um. Seine Muttersprache war der elsässische Ortsdialekt des Alemannischen. Das Hochdeutsche erlernte Schweitzer erst in der Schule. Daneben wurde in seiner Familie auch Französisch gesprochen. Nach dem Abitur 1893 in Mülhausen studierte Schweitzer an der Universität Straßburg Theologie und Philosophie. Zudem studierte er in Paris bei Charles-Marie Widor Orgel und war Mitglied der Studentenverbindungen Wilhelmitana Straßburg und Nicaria Tübingen im Schwarzburgbund. 1899 wurde er in Berlin aufgrund einer Dissertation über Die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft zum Dr. phil. promoviert. 1901 folgte die theologische Dissertation zum Lic. theol. Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen (Erstauflage 1906), die in der zweiten Fassung den Titel Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Tübingen 1913) trägt. 1902 erfolgte an der Universität Straßburg die Habilitation in Evangelischer Theologie mit der Schrift Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis. Mit der Habilitation wurde er Dozent für Theologie an der Universität Straßburg und Vikar an der Kirche St. Nikolai. Seine Theologie fand unter anderem bei Fritz Buri Nachhall. Schweitzer schrieb 1905 die französische Ausgabe von Johann Sébastien Bach, auf die drei Jahre später 1908 seine neu verfasste deutsche Bach-Monographie folgte. Von 1905 bis 1913 studierte Albert Schweitzer Medizin in Straßburg mit dem Ziel, in Gabun (Afrika) als Missionsarzt tätig zu werden. Die Immatrikulation zum Studium der Medizin war sehr kompliziert. Schweitzer war ja bereits Dozent an der Universität Straßburg. Erst eine Sondergenehmigung der Regierung machte das Studium möglich. 1912 wurde er zum Arzt approbiert, im gleichen Jahr wurde ihm der Titel eines Professors verliehen auf Grund seiner „anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistungen“. 1913 folgte seine medizinische Doktorarbeit Die psychiatrische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik.[2] In dieser Arbeit widerlegt er, analog seiner theologischen Dissertation, zeitgenössische Versuche, das Leben Jesu aus psychiatrischer Sicht zu beleuchten. Somit war er, im Alter von 38 Jahren und bevor er nach Afrika ging, in drei verschiedenen Fächern promoviert, hatte sich habilitiert und war Professor. Albert Schweitzer heiratete 1912 Helene Bresslau (1879-1957), die Tochter des jüdischen Historikers Harry Bresslau und dessen Frau Caroline, geborene Isay. 1919 wurde die Tochter Rhena Schweitzer-Miller († 2009) geboren, die bis 1970 die Stiftung ihres Vaters weiterführte. Leben als Mediziner in Afrika und Europa Das Einzugsgebiet des Ogooué erstreckt sich über den größten Teil Gabuns. Lambaréné liegt am westlichen Unterlauf des Flusses und ist auf der linken Kartenhälfte gekennzeichnet. 1913 setzte Schweitzer sein Vorhaben in die Tat um und gründete in Französisch-Äquatorialafrika (heute Gabun), am Ogooué, einem 1200 km langen Fluss der afrikanischen Westküste, das Urwaldhospital Lambaréné.[3] Schon ab 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden er und seine Frau Helene, eine Lehrerin, als Deutsche von der französischen Armee unter Hausarrest gestellt. 1917, erschöpft von mehr als vier Jahren Arbeit und von einer Art tropischer Anämie, wurde das Ehepaar Schweitzer festgenommen, von Afrika nach Frankreich überführt und in Bordeaux, Garaison und dann St. Rémy de Provence bis Juli 1918 interniert. Diese Zeit nutzte Albert zur Entwicklung und zum Ausbau seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Zentral für diese Ethik ist der Satz: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Gegen Kriegsende kamen sie 1918 ins Elsass zurück, das am 6. Dezember wieder an Frankreich angeschlossen wurde. Dort erhielt Schweitzer die französische Nationalität, nahm wieder die Stelle als Vikar in St. Nikolai in Straßburg an und trat als Assistenzarzt in ein Straßburger Spital ein. Dank des schwedischen Bischofs Nathan Söderblom konnte Albert Schweitzer ab 1920 in Schweden Vorträge über seine Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ halten, mittels Orgelkonzerten seine Schulden bezahlen und Geld für die Rückkehr 1924 nach Afrika verdienen, um dort das Urwaldhospital auszubauen. Bekannt wurde Albert Schweitzer vor allem durch sein Buch „Zwischen Wasser und Urwald“, das er in kurzer Zeit 1921 geschrieben hatte. In seiner Rede zum 100. Todestag Johann Wolfgang von Goethes 1932 in Frankfurt am Main warnte Schweitzer vor den Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus. Albert-Schweitzer-Monument im australischen Wagga Wagga Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm viel öffentliche Ehre zuteil. In seiner erst 1954 gehaltenen Dankesrede zur Verleihung des Friedensnobelpreises von 1952 sprach sich Schweitzer deutlich für eine generelle Verwerfung von Krieg aus: „Krieg macht uns der Unmenschlichkeit schuldig“, „zitiert“ Albert Schweitzer Erasmus von Rotterdam. Infolge der Genfer Konvention von 1864 und der Gründung des „Roten Kreuzes“ sei es zu einer „Humanisierung des Krieges“ gekommen, die dazu geführt hätte, dass die Menschen 1914 den beginnenden Ersten Weltkrieg nicht in der Weise ernst genommen hatten, wie sie dies hätten tun sollen. Albert Schweitzer war 44 Jahre alt, als seine elsässische Heimat 1918 als Folge des Ersten Weltkrieges wieder dem französischen Staatsgebiet zugeordnet wurde. Damit erhielt er die französische Staatsangehörigkeit. Er selbst bezeichnete sich jedoch gern als Elsässer und „Weltbürger“; Deutsch und Französisch beherrschte er fast gleich gut. Mit Frankreich verband ihn u. a. Jean-Paul Sartre, der Sohn von Schweitzers Cousine Anne-Marie. Die kritische Auseinandersetzung mit der gerade in Frankreich populär gewordenen Existenzphilosophie beschäftigte ihn noch in seinen letzten Lebensjahren. Schweitzers Großneffe Louis Schweitzer war von 1992-2005 Vorstandsvorsitzender des französischen Automobilkonzerns Renault. Günsbach ist Sitz der Internationalen Albert Schweitzer Vereinigung. Die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben [Bearbeiten] Das Problem der Ethik in der Höherentwicklung des menschlichen Denkens [Bearbeiten] Schweitzer geht 1962 in der Quintessenz seines philosophischen Denkens davon aus, dass sich Menschen beim Nachdenken über sich selbst und ihre Grenzen wechselseitig als Brüder erkennen, die über sich selbst und ihre Grenzen nachdenken. Im Zuge des Zivilisationsprozesses wird die Solidarität, die ursprünglich nur auf den eigenen Stamm bezogen war, nach und nach auf alle, auch unbekannte Menschen übertragen. In den Weltreligionen und Philosophien sind diese Stadien der Kulturentwicklung konserviert. Albert Schweitzer auf einer Zeichnung von Arthur William Heintzelman (1950er Jahre) Analog wirkt in den weltverneinenden Religionen des indischen Kulturkreises nach der Philosophie von Arthur Schopenhauer eine Ausbreitung des Mitleids, das im Brahmanismus jenseits der (wahren) Metaphysik im Leid der (falschen) materiellen Welt begründet ist und deshalb abgelehnt, im Buddhismus mit Bezug auf eine erweiterte Metaphysik gefordert und im Hinduismus ins Alltagsleben integriert wird, das als Spiel der Götter mit Menschen verstanden wird (Bhagavad Gita). Die geforderte Teilnahmslosigkeit gegenüber Leid verpflichtet zum Pazifismus. Schweitzer bezog sich auch auf Mahatma Gandhi. Auch die Ausbreitung des weltbejahenden Zoroastrismus persischer Siedler, vereint in Solidarität gegen heidnische Nomaden, beeinflusst die griechische Philosophie, in der der Stoiker Panätios die Weltbejahung mit einer allumfassenden Vernunft begründet, in der Seneca, Epiktet und Marc Aurel als Tugend aller Tugenden den Humanismus entwickeln. Im Schmelztiegel der persischen und der griechischen Kultur waren das Judentum und das Christentum entstanden, die die Welt als wahr, aber unvollkommen sehen. Das Christentum fordert Weltentsagung zur Ausweitung des Guten im Menschen und findet auf der Suche nach dem Gebot aller Gebote ebenfalls zum Ideal des Humanismus. Seit der Renaissance verwachsen die außengeleitete Tugend aller Tugenden und das innengeleitete Gebot aller Gebote zu einem weltlichen Recht (Erasmus von Rotterdam), Grundlage für den Utilitarismus von Jeremy Bentham, während David Hume eine natürliche Empathie als Ursache annimmt. Immanuel Kant verbindet diese mit dem Dualismus und verlegt die Moral in der Form des Kategorischen Imperativ in die Natur des Menschen, der in der geistigen Welt als Subjekt lebt und in der gegenständlichen nur Objekt ist. Das häufige Scheitern am moralischen Anspruch macht aus dem guten Gewissen einen Mythos, während die Zivilisation das Vertrauen und den Sinn mit der Folge von Resignation und reaktiver Sentimentalität untergräbt. Damit dieser Druck dazu führt, dass das Subjekt sein Sein als „Wille zum Leben inmitten vom Willen zum Leben“ anderer begreift und diese Erfahrung mit dem Liebesgebot Jesus unterfüttert, braucht es Anleitung. Dann verbindet es die Gebote des Gewissens in der Form des Kategorischen Imperativ in der geistigen Welt mit den Tugenden in der gegenständlichen Welt und erkennt den Unterschied zwischen böse und gut als Ausdruck lebensschädigender und lebensfördernder Wirkungen und findet darin den höchsten sittlichen Wert. Dieser sittliche Wert ermöglicht eine Lebensanschauung, in der Lebensbejahung keine Erkenntnis-, sondern eine Willenskategorie ist, Lebensverneinung in der Rücksichtnahme auf den Willen anderer liegt und Lebensentsagung im verinnerlichenden, sich selber sammelnden (Musik) und vervollkommnenden Gebot besteht, auch das eigene Leben aus Berufung auf den sittlichen Wert der Ethik zu heben, die Volksweisheiten von „Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' auch keinem andern zu“ bis hin zu „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ vereint und auf alles Lebendige überträgt. „Ethische Kultur“. Mensch und Kreatur [Bearbeiten] Entscheidungen zwischen Moral und Sachzwang führen zur Beschäftigung mit dem Ideal der Ethik, in die der Mensch hineinwächst. Die Verantwortung braucht einen individuellen, sozialen und politischen Willen, der dem eigenen Dasein einen geistigen Wert verleiht und zur gegenständlichen Welt ein Verhältnis knüpft, in dem der Mensch von einer naiven zu einer vertieften Weltbejahung gelangt. Elementares Denken ist die Voraussetzung einer verständlichen und überzeugenden Ethik, die bei der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in dieser wie Sauerteig im Brot wirkt. Das zwischenmenschliche Verhältnis ist von Fremdheit und Kälte geprägt, weil sich niemand traut, sich so herzlich zu geben, wie er ist. Die Überwindung verwurzelt die Herzlichkeit in der Ehrfurcht vor dem Leben und verhilft zu einer Güte in Bescheidenheit, weil man bei jeder Entscheidung immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und zu resignieren droht. Doch gerade die Jugend verfügt über die Energie, die resignierte Vernünftigkeit der gereiften Persönlichkeit zu hinterfragen und hat den Mut, einen moralischen Kompass für einen lebensfördernden Umgang mit Sachzwängen zu justieren. Da die Kreatur wehrlos der menschlichen Willkür ausgesetzt ist, beziehen ethische Entscheidungen die Willkür mit ein und schädigen Leben nicht aus Gedanken- oder Teilnahmslosigkeit. Mitleid mit Tieren ist trotz ihrer angeblichen Seelenlosigkeit keine Sentimentalität, denn alles notwendige Töten ist ein Grund zu Trauer und Schuld, der man nicht entkommen, die man nur verringern kann. Albert Schweitzer ist zur Schonung der Tiere zur vegetarischen Ernährung übergegangen. „Meine Ansicht ist, dass wir, die für die Schonung der Tiere eintraten, ganz dem Fleischgenuss entsagen und auch gegen ihn reden. So mache ich es selber.“[4] Atomkrieg oder Frieden Im Pazifismus, oft als Utopie belächelt, sieht Schweitzer ein überlebenswichtiges Gegengewicht zur Patt-Situation der Abschreckung. Die Gesinnung der Unmenschlichkeit will sich die Entscheidungsfreiheit über Krieg oder Frieden als Voraussetzung der Friedensgarantie mit einer Position der Stärke erhalten. Sie übersieht die Bedrohung der Stärke durch die Ausweitung von Sachzwängen zur Aufrüstung mit der Folge einer Steigerung der Kriegsgefahr als selbsterfüllende Prophezeiung (Rüstungsspirale). Sie bemerkt nicht, dass auch der Sieger vom Sieg nichts hat. Trotz aller Zweifel rät Schweitzer aus Angst vor der Gesinnung der Unmenschlichkeit zur einseitigen Abrüstung. Da die resignierte Vernunft nicht erkennt, dass Vernichtungskriege mehr Probleme schaffen als lösen, kann die Ehrfurcht vor dem Leben nur mit Mut die Hoffnung entwickeln, mit der die Öffentlichkeit die Idee einer weltbejahenden Kultur entwirft und die Verantwortung über Krieg und Frieden übernimmt. Verbindungen zu anderen philosophischen Strömungen Vereinzelte stehen einer absoluten Wirklichkeit gegenüber, die wegen ihrer Transzendenz so unverständlich ist, dass sie sich in ihr nur ihre einzelnen Vorstellungswelten errichten können, in denen sich, jeweils in Objekt und Subjekt getrennt, der Wille der absoluten Wirklichkeit widerspiegelt. Der Wille an sich ist einerseits frei, aber blind, andererseits sehend, da von der eigenen Vorstellung festgelegt (Determinismus), aber unfrei. Deshalb kann das Subjekt den Willen nicht mehr zur Unterscheidung von Schöpfung und Zerstörung nutzen und Sinn entwickeln. Schweitzer sieht die Essenz zur Überwindung dieses Paradox a priori im Menschen angelegt, Inneres wird entsprechend externalisiert. Im Existentialismus von Jean-Paul Sartre, Großneffe Schweitzers, der von den gleichen Vorstellungen ausgeht, steht der Sinnlosigkeit die freie Verantwortung des vereinzelten Gewissens gegenüber, das sich allerdings in seiner Ich-Bezogenheit seine Essenz in der Intersubjektivität durch das Eintreten für bestimmte Werte selber schafft: Außeneinflüsse werden entsprechend internalisiert. Auszeichnungen [Bearbeiten] Deutsche Briefmarke (2000) zum 125. Geburtstag von Albert Schweitzer. Bernhard-Nocht-Medaille 1928: Goethepreis der Stadt Frankfurt 1949: Ehrenbürger der Stadt Königsfeld im Schwarzwald 1951: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1951: Johann-Peter-Hebel-Preis 1952: Paracelsus-Medaille 1952: Friedensnobelpreis (Im Oktober 1953 rückwirkend für 1952 zuerkannt; entgegengenommen am 4. November 1954 in Oslo) 1952: Die schwedische Prinz Karl-Medaille, verliehen für verdienstvolle humanitäre Betätigung 1952: Wahl in die Académie des sciences morales et politiques als Nachfolger Philippe Pétains 1954: Pour le mérite für Wissenschaft und Künste 1958: Ehrendoktor der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster 1959: Ehrenbürger der Stadt Frankfurt am Main 1959: Sonning-Preis der Universität Kopenhagen 1964: Ehrendoktor der Technischen Universität Braunschweig Zitate [Bearbeiten] „Diese vornehme Kultur, die so erbaulich von Menschenwürde und Menschenrechten zu reden weiß und diese Menschenrechte und Menschenwürde an Millionen und Millionen missachtet und mit Füßen tritt, nur weil sie über dem Meere wohnen, eine andere Hautfarbe haben, sich nicht helfen können; diese Kultur, die nicht weiß, wie hohl und erbärmlich, wie phrasenhaft und gemein sie vor denjenigen steht, die ihr über die Meere nachgehen und sehen, was sie dort leistet, und die kein Recht hat, von Menschenwürde und Menschenrechten zu reden. [...] An was denken unsere Staaten, wenn sie den Blick übers Meer richten? [...] was sie aus dem Lande ziehen können, immer zu ihrem Vorteil. Wo sind die Arbeiter, die Handwerker, die Lehrer, die Gelehrten, die Ärzte, die in diese Länder ziehen? Macht unsere Gesellschaft eine Anstrengung in dieser Hinsicht? Nichts. [...] Das Christentum wird zur Lüge und Schande, wenn nicht, was draußen begangen, gesühnt wird, nicht für jeden Gewalttätigen im Namen Jesu ein Helfer kommt, für jeden, der etwas raubt, einer, der etwas bringt, für jeden, der flucht, einer, der segnet.“ (Predigt zum Missionsfest am 6. Januar 1907 in der Kirche St. Nikolai in Straßburg.)[29] „Für den Primitiven hat die Solidarität enggezogene Grenzen. Sie beschränkt sich auf seine Blutsverwandten im engeren Sinne, das heißt, auf die Mitglieder seines Stammes, die für ihn die Familie im Großen repräsentieren. Ich spreche aus Erfahrung. In meinem Spital habe ich solche Primitiven. Wenn ich einem nicht bettlägerigen Patienten aus dieser Gruppe kleine Dienste für einen Kranken auftrage, der das Bett hüten muss, wird er es nur dann tun, wenn dieser des gleichen Stammes ist wie er. Ist dies nicht der Fall, wird er mir treuherzig antworten: ‚Dieser ist nicht Bruder von mir.‘ Weder durch Belohnung noch durch Drohung wird er sich bewogen fühlen, diesem Fremden einen Dienst zu leisten.”[30] „Wer in diesen Abgrund von Qual, welche die Menschen über die Tiere bringen, hineingeblickt hat, der sieht kein Licht mehr; es liegt wie ein Schatten über allem, und er kann sich nicht mehr unbefangen freuen.“[31] „Ja, das große Problem, ob wir Tiere töten und essen dürfen, wird uns langsam bewusst. Es lässt sich viel dagegen und auch manches dafür sagen. Das Problem ist ja erst spät sichtbar geworden. Meine Ansicht ist, dass wir, die wir für die Schonung der Tiere eintreten, ganz dem Fleischkonsum entsagen und auch gegen ihn reden. So mache ich es selber. Und damit kommen so manche dazu, auf das Problem, das so spät aufgestellt wird, aufmerksam zu machen.“[32] „Anfang alles wertvollen geistigen Lebens ist der unerschrockene Glaube an die Wahrheit und das offene Bekenntnis zu ihr. Auch die tiefste religiöse Erkenntnis liegt nicht außerhalb des Denkens.“[33] Werke [Bearbeiten] Gesammelte Werke Gesammelte Werke in fünf Bänden. Hrsg. von Rudolf Grabs. Beck, München 1974. Bd. 1: Aus meinem Leben und Denken; Aus meiner Kindheit und Jugendzeit; Zwischen Wasser und Urwald; Briefe aus Lambarene 1924-1927. Bd. 2: Verfall und Wiederaufbau der Kultur; Kultur und Ethik; Die Weltanschauung der indischen Dichter; Das Christentum und die Weltreligionen. Bd. 3: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Bd. 4: Die Mystik des Apostels Paulus; Reich Gottes und Christentum. Bd. 5: Aus Afrika; Kulturphilosophie und Ethik; Religion und Theologie; Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst; Goethe. Vier Reden; Ethik und Völkerfrieden. Das Albert Schweitzer Lesebuch. Beck, München 1995. Schriften zur Theologie Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart. Olms, Hildesheim 2004. (Nachdruck der Ausgabe bei Mohr, Tübingen 1911) Die Mystik des Apostels Paulus. Mohr, Tübingen 1981. (Neudruck der 1. Auflage 1930) Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. 6. photomechanisch gedruckte Auflage, Mohr, Tübingen 1951. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. 9. Auflage, Mohr, Tübingen 1984. Das Abendmahl im Zusammenhang der Geschichte Jesu und der Geschichte des Urchristentums. Olms, Hildesheim 1983. (Nachdruck der Ausgabe Tübingen 1901) Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis: eine Skizze des Lebens Jesu. 1983. Straßburger Predigten. Beck, München 1986. Das Christentum und die Weltreligionen. Beck, München 1923. Schriften zur Philosophie Die Ehrfurcht vor dem Leben - Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. Beck, München 1991. (6. Auflage) Ehrfurcht vor den Tieren - Ein Lesebuch. Beck, München 2006 (1. Auflage) Die Weltanschauung der indischen Denker: Mystik und Ethik. Beck, München 1987. Die Religionsphilosophie Kants. Olms, Hildesheim 1990 (zuerst J.C.B.Mohr, Freiburg i.B., Leipzig, Tübingen 1899) Kulturphilosophie. Bd. 1: Verfall und Wiederaufbau der Kultur; Bd. 2. Kultur und Ethik. Beck, München 1923. Das Problem des Friedens in der heutigen Welt. Beck, München 1955. Musikwissenschaftliche Schriften Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Orgelkunst. Faksimile-Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1906 und des Nachwortes der 2. Aufl. 1927, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, ISBN 978-3-7651-0230-1. Johann Sebastian Bach. 1908; Nachdruck Breitkopf und Härtel, Wiesbaden 1979, ISBN 3-7651-0034-X. Zur Diskussion über Orgelbau. 1914; Hrsg. Erwin R. Jacobi. Verlag Merseburger, Berlin 1977. Der für Bachs Werke für Violine Solo erforderliche Geigenbogen. In: Bach - Gedenkschrift, Zürich 1950. Autobiographische Schriften Aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Beck, München 1991. Zwischen Wasser und Urwald. Erlebnisse und Beobachtungen eines Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas. Paul Haupt, Bern 1921; ab 1925 auch C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München. Der Textauszug aus der Auflage von 1926 Von Straßburg nach Lambarene ist mit einer Kurzbiografie erschienen in: Von Grönland bis Lambarene. Reisebeschreibungen christlicher Missionare aus drei Jahrhunderten. Herausgegeben von Johannes Paul. Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1952 (Seite 182-192) = Kreuz-Verlag Stuttgart 1958 (Seite 180-191). Aus meinem Leben und Denken. Meiner Verl., Leipzig 1931 Briefwechsel Albert Schweitzer / Fritz Buri: Existenzphilosophie und Christentum. Briefe 1935-1964. Eingeleitet, kommentiert und hrsg. von Andreas Urs Sommer. München 2000, ISBN 3-406-46730-X.
Sources
| 1 | Wikipedia |
| 2 | Geneanet |
| 3 | 2013 GFF-Datenvergleich GF9236, Gesellschaft fuer Familienforschung in Franken e.V. www.gf-franken.de
Author: Gesellschaft für Familienforschung in Franken
|
files
| Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
| Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
| Id | 56553 |
| Upload date | 2024-10-22 13:20:26.0 |
| Submitter |
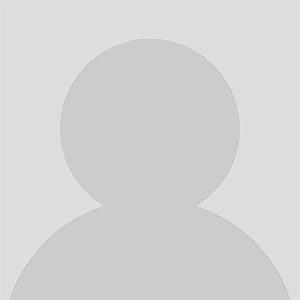 Erika Elisabeth Metzieder
visit the user's profile page
Erika Elisabeth Metzieder
visit the user's profile page
|
| info@metzieder.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.