Ruprecht III. VON DER PFALZ
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Ruprecht III. VON DER PFALZ |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | 18. May 1410 | Oppenheim, RP, D
Find persons in this place |
|
| birth | 5. May 1352 | Amberg (Oberpfalz)
Find persons in this place |
|
| marriage | 27. June 1374 | Amberg (Oberpfalz)
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
27. June 1374
Amberg (Oberpfalz) |
Elisabeth VON NÜRNBERG |
|
Notes for this person
Nachdem Pfalzgf. Ruprecht II. und sein Sohn R. angesichts der Agonie von Wenzels Königsherrschaft schon seit 1395/96 zielstrebig und zusammen mit den rhein. Erzbischöfen darauf hingewirkt hatten, wurde R. am 21.8.1400 in Rhens zum neuen Reichsoberhaupt gewählt und ohne die üblichen Reichsinsignien am 6.1.1401 in Köln gekrönt. Trotz dieser Traditionsbrüche war die Legitimation von R.s Königtum nicht strittig; der abgesetzte Wenzel wollte es im Sommer 1401 sogar selbst anerkennen. Um zu zeigen, daß ihm im Gegensatz zu Wenzel an einer aktiven Politik gelegen war, und um gleichzeitig die Kaiserkrönung sowie die Rückgewinnung Mailands für das Reich zu bewerkstelligen, brach R. noch 1401 zu einem Italienzug auf. Das Vorhaben, das aufgrund unzureichender Geldmittel scheiterte, schwächte R.s Position empfindlich: Enttäuscht kehrten ihm viele Anhänger den Rücken. Dagegen verlief die für den Sohn Ludwig aufgenommene Brautwerbung am engl. Hof im Juli 1402 erfolgreich - in der angespannten finanziellen Lage kam der Aussteuer in Höhe von 100 000 Gulden hohe Bedeutung zu. Die Heirat entsprach, wie die 1407 gefeierte Hochzeit von R.s Sohn Johann mit Katharina, der Schwester des nord. Unionskg. Erich v. Pommern, der neuen Stellung des Hauses. Ein weiterer Erfolg gelang am 1.10.1403, als Bonifaz IX. R. die zunächst zurückgehaltene Approbation erteilte. Der nun nochmals ins Auge gefaßte Italienzug kam jedoch nicht mehr zustande. R.s Itinerar, das räumlich beschränkteste der mittelalterlichen Könige, bezeichnet seinen begrenzten Wirkungsbereich. Seinem Heidelberger Hof fehlte der kgl. Glanz, ein Beziehungsnetz zur Reichskirche konnte R. nur in Ansätzen aufbauen. In seiner Herrschaft stützte er sich auf die kurpfälz. Kanzlei, die mit Hilfe Heidelberger Universitätsgelehrter zur kgl. Kanzlei ausgebaut wurde. Reichsregistraturbücher, in denen die ausgestellten Urkunden erfaßt wurden, das älteste Lehnsbuch der Kurpfalz und das erste Reichslehnsbuch sind R.s Initiative zu verdanken. Das Hofgericht, ebenso mit gelehrten Räten besetzt wie die Kanzlei, erlebte eine institutionelle Festigung. Durchdrungen von der Pflicht zur kgl. Rechtswahrung, förderte R. die Feme bzw. die westfäl. Freigerichte, wovon die im Mai 1408 in Heidelberg an die westfäl. Freigrafen gerichteten „Rupertinischen Fragen", fortan Grundlage aller Aufzeichnungen im Zusammenhang der Feme, ein eindrucksvolles Zeugnis ablegen. R. nahm das Richteramt persönlich wahr und wurde als Schiedsrichter geradezu überbeansprucht. Auch beim Zollwesen oder der geplanten Münzreform mit Golddukaten als kgl. Leitwährung zeigt sich sein Bemühen, alte Königsrechte zu aktivieren und eine direkte Reichsherrschaft auszuüben. Beides scheiterte am Widerstand der rhein. Erzbischöfe. Besser gelang es R., das Regal des Geleitrechts und - aus fiskalischen Gründen - den kgl. Judenschutz zu bewahren. Dazu reorganisierte er die Abgabe des Goldenen Opferpfennigs, der einzigen Kopfsteuer im Reich, und richtete 1407 das Amt eines jüd. Hochmeisters ein. Von Anfang an fehlte R.s Königtum eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage. Um den finanziellen Ruin zu vermeiden, zog R. neben Verpfändungen und den Mitgiften seiner Schwiegertöchter die Einkünfte seines eigenen Territoriums heran. Darüber hinaus drohte sich seine Herrschaft in territorialen Auseinandersetzungen innerhalb des Reichsgefüges zu verlieren. Die von R. initiierten Landfrieden räumten die Rivalitäten zwischen den Territorialherren nicht aus, zumal R. selbst als solcher agierte. Kurmainz, Baden und Württemberg schlossen sich 1405 mit Straßburg und 17 schwäb. Städten gegen R. zum Marbacher Bund zusammen. 1407 vereinbarten R. und der Mainzer Ebf. Johann II., im Reich kein Bündnis ohne Vorwissen und Einwilligung des anderen mehr zu schließen, wofür der Marbacher Bund über 1411 hinaus nicht mehr verlängert werden sollte. Diese Lösung, von der älteren Forschung als Kapitulation R.s gewertet, führte zu neuem Handlungsspielraum; demonstrativ bestieg R. am 14.11.1407 in Aachen den Thron Karls d. Gr. Nachdem R. hinsichtlich der Wahrung der Reichsinteressen im Westen und in Italien sowie der Schaffung eines Landfriedens kaum etwas erreicht hatte, wandte er sich verstärkt der Lösung des seit 1378 bestehenden Schismas zu. Wohl gleichermaßen aus Gewissensgründen wie aus politischem Kalkül hielt er, dem die Kirchenreform ein inneres Anliegen war, wie v. a. die besondere Förderung der Benediktiner in Kastl zeigt, an der röm. Obödienz fest. In der sog. Heidelberger Appellation vom 23.3.1409 ließ R. erklären, daß das Konzil von Pisa infolge seiner Einberufung allein durch Kardinäle unrechtmäßig und ein allgemeines Konzil einzuberufen sei. Er bewahrte damit die Rolle des Königtums als Beschützer der Kirche, fand sich aber isoliert, als in Pisa mit Alexander V. ein dritter Papst gewählt und Wenzel wieder als König anerkannt wurde. In Deutschland versuchte der Mainzer Ebf. Johann II., den Marbacher Bund zu reaktivieren, und betrieb die Absetzung R.s. Zu dem unausweichlich erscheinenden Krieg kam es jedoch nicht mehr, da R., der mit dem hess. Landgrafen bereits einen Angriffsplan für Juni 1410 ausgearbeitet hatte, wenige Wochen vor diesem Termin nach kurzer Krankheit starb. R.s Testament sicherte seinem ältesten Sohn Ludwig und der von ihm ausgehenden Kurlinie das Erbrecht am Kern der Kurpfalz zu, und fixierte damit das sog. „Kurpräzipuum". Die Räte teilten Ludwig vorab die unveräußerlichen Teile der nach der Goldenen Bulle unteilbaren Kurpfalz zu und splitterten den verbleibenden Besitz unter allen vier Söhnen in annähernd gleich große Komplexe auf. Die jüngeren Söhne Johann, Stephan sowie Otto erhielten die Herrschaften Neumarkt, Simmern-Zweibrücken bzw. Mosbach als Herzogtümer. Die Erweiterung der territorialen Machtgrundlage seiner Dynastie war R. damit gelungen: Trotz der Aufteilung der Pfalzgrafschaft in vier Teile war Ludwigs III. Einzelerbe 1410 größer als die 1395 zur Verfügung stehende Besitzmasse. Bemühungen R.s, die Reichskrone für seine Familie zu bewahren, sind dagegen nicht zu erkennen. Die Krone ging durch Wahl erstaunlich reibungslos an das Haus Luxemburg zurück, nicht an den immer noch lebenden Wenzel, aber an dessen jüngeren Bruder Sigismund. Ob R. damit als gescheiterter König zu betrachten ist, wie teilweise behauptet, erscheint fraglich. Obwohl R. von Beginn seiner Königsherrschaft an viele Rückschläge in wichtigen Bereichen seiner Politik erlitt, bemühte er sich doch mit nicht nachlassender|Kraft, von der stark beschädigten monarchischen Autorität soviel wie möglich zu wahren, und gab zudem wichtige Anstöße für die spätere Reichsreform. Quelle: Auge, Oliver, "Ruprecht von der Pfalz" in: Neue Deutsche Biographie 22 (2005), S. 283-285 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118750410.html#ndbcontent
Sources
| 1 | Lexikon deutscher Herrscher und Fürstenhäuser, 220
Author: Heinrich Klauser
Publication: Verlag Ullstein GmbH 1995, Ullstein-Buch Nr. 35533, ISBN 3-548-35533-1
Abbreviation: Lexikon deutscher Herrscher und Fürstenhäuser
|
| 2 | Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VI, Familien des Alten Lotharingen I, 17
Author: Schwennicke, Detlev (Herausgeber)
Publication: Verlag von J. A. Stargard, Marburg 1978
Abbreviation: Europäische Stammtafeln 06, Familien des Alten Lotharingen I
|
| 3 | Die Vorfahren der Familie Steinlin von St. Gallen, 1-4, 280-A, 297, 301.
Author: Uli W. Steinlin
Publication: Basel, Schweiz: Kommisonsverlag Krebs AG, 2008.
Abbreviation: Die Vorfahren der Familie Steinlin von St. Gallen
|
| 4 | GÉNÉALOGIES - 30000 ancêtres de Henri d'Orléans comte de Paris (1908-1999), 16-467.
Author: André de Moura
Publication: Paris, Frankreich: L'Harmattan, 2001.
Abbreviation: GÉNÉALOGIES - 30000 ancêtres de Henri d'Orléans comte de Paris (1908-1999)
|
| 5 | Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark -936-) I.-XVI. Generation, 2790, 2994, 3007, 3035.
Author: S. Otto Brenner
Publication: Lyngby: Dansk Historisk Haandbogsforlag, 2. Auflage 1978.
Abbreviation: Nachkommen Gorms des Alten
|
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
files
| Title | Familienforschung Peters |
| Description | |
| Id | 64797 |
| Upload date | 2023-04-12 20:31:06.0 |
| Submitter |
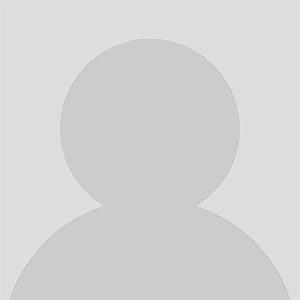 Dirk Peters
visit the user's profile page
Dirk Peters
visit the user's profile page
|
| mail@dirkpeters.net, dirkpeters@hotmail.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.